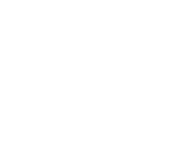Vorschau
Heft 2/2026: Beurteilen in der Lehrer:innenbildung
Der Themenbereich «Beurteilen» hat für eine wirksame Lehrer:innenbildung hohe Relevanz. Dies zeigt sich auch daran, dass die Thematik seit vielen Jahren in unterschiedlichen Facetten bearbeitet wird. Bereits frühere Themenhefte der BzL haben sich mit Aspekten der Beurteilung befasst, beispielsweise mit Leistungsnachweisen in der Lehrer:innenbildung (1/2007), Pädagogischer Diagnostik (2/2013) oder mit wissenschaftlichen Abschlussarbeiten (Doppelnummer in 2021). Die grundlegende Aufgabe einer Beurteilung im Bildungskontext liegt darin, lern- oder entwicklungsrelevante Merkmale akkurat einzuschätzen. Ein diagnostisches Urteil stellt jedoch keinen Selbstzweck dar, sondern schafft eine fundierte Grundlage zur Feststellung des Lern- oder Leistungsstands, um daraus Massnahmen für die Förderung und Unterstützung der professionellen Entwicklung von künftigen Lehrpersonen (formative Beurteilung) ableiten zu können oder um Selektionsentscheide (summative Beurteilung) zu fällen, zu begründen und zu legitimieren.
Im geplanten Themenheft 2/26 geht es um Fragen des Beurteilens professioneller Kompetenzen in der Ausbildung von künftigen Lehrpersonen. Dabei sollen aktuelle Themenbereiche und kontroverse Diskussionsfelder aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden: Was wird unter Studierfähigkeit in der Lehrer:innenbildung verstanden, wie wird sie erfasst und wie lässt sie sich fördern? Wie lassen sich professionelle Kompetenzen von (künftigen) Lehrpersonen in Praktika beurteilen? Mit welchen (innovativen) Methoden werden relevante berufsspezifische Kompetenzen beurteilt und wie werden sie gefördert? Welche Verfahren werden zur Erfassung von überfachlichen Kompetenzen angewandt?
Nicht im Fokus dieses Themenhefts sind somit Fragen zur Beurteilung als professionelle Kompetenz von Lehrpersonen für ein erfolgreiches Diagnostizieren auf der Zielstufe. Ebenso klammern wir den Themenkomplex «Beurteilen und künstliche Intelligenz» aus, weil wir den Entwicklungen rund um die Künstliche Intelligenz und deren Bedeutung für die Lehrer:innenbildung ein eigenes Themenheft (1/27) widmen möchten.
Beitragsanfragen zum Themenheft «Beurteilen in der Lehrer:innenbildung» können an die Redaktionsmitglieder Afra Sturm und Christian Brühwiler gerichtet werden.
Heft 3/2026: Inklusive Lehrpersonenbildung und Inklusion – Herausforderungen und Perspektiven im Kontext von Behinderung
Im Zentrum des Themenhefts 3/26 steht die Dimension «Behinderung» im Kontext der Inklusion und die damit verbundenen Anforderungen an die Professionalisierung von Lehrpersonen und die institutionelle Entwicklung der Hochschulen. Der entsprechende politische Auftrag zur Gestaltung eines inklusiven Schulsystems ist völkerrechtlich in der UN-Behindertenrechtskonvention klar verankert. Die Ratifizierung verpflichtet die Vertragsstaaten zur Gewährleistung eines integrativen Bildungssystems auf allen Ebenen. Auf diese Weise soll Menschen mit Beeinträchtigungen der gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Zugang zu schulischer und akademischer Teilhabe ermöglicht werden.
Die Umsetzung dieser Vorgabe wirft zentrale Fragen auf, wie zum Beispiel: Wie muss die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen zukünftig gestaltet sein, um diesem Anspruch gerecht zu werden? Und wie können Lehrpersonen umfassend auf die Herausforderungen und Potenziale von Vielfalt vorbereitet werden?
Das Themenheft 3/26 mit dem Titel «Inklusive Lehrpersonenbildung und Inklusion – Herausforderungen und Perspektiven im Kontext von Behinderung» widmet sich der wissenschaftlichen Analyse dieser notwendigen Transformationen. Es fokussiert auf die damit verbundenen Anforderungen an die Professionalisierung sowie die institutionelle Entwicklung der Hochschulen.
Verantwortliche Redaktionsmitglieder: Afra Sturm und Sandra Moroni
Heft 1/2027: KI in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Künstliche Intelligenz (KI) – verstanden als datenbasierte, algorithmische Systeme zur Analyse, Generierung und Unterstützung menschlicher Entscheidungen – prägt zunehmend die Rahmenbedingungen von Lehr- und Lernprozessen. Mit dieser Ausgabe der BzL richten wir den Fokus auf die Frage, wie diese Entwicklungen die Lehrerinnen- und Lehrerbildung herausfordern und welche institutionellen und pädagogisch-didaktischen Antworten erforderlich werden. Das Themenheft soll einen entsprechenden Überblick ermöglichen. Im Zentrum steht dabei ein reflektierter und empirisch begründeter Umgang mit KI in professioneller Verantwortung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung.
Die aktuelle Nummer der BzL nimmt zunächst veränderte Lehr- und Lernkulturen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in den Blick und fragt, wie KI beispielsweise Feedback-Prozesse beeinflusst oder inwiefern durch KI neue Formen individueller Förderung und veränderter Interaktionen zwischen Lernenden, Lehrpersonen und digitalen Systemen eröffnet werden. Das Themenheft soll einen Beitrag zur Analyse leisten, welche Verschiebungen hier bereits sichtbar sind und wie Institutionen der Lehrpersonenbildung mit Fragen der Integration, Regulierung oder bewussten Begrenzung von KI umgehen. Dabei richtet diese Ausgabe der BzL den Blick auch pädagogische und fachdidaktische Implikationen. So adressieren die Beiträge die Frage, wie sich diesbezüglich die Lehrerinnen- und Lehrerbildung anpassen müsste, um zukünftige Lehrpersonen systematisch auf einen reflektierten und fachlich begründeten Umgang mit KI vorzubereiten. Weiter thematisieren die Beiträge, wie Lehrpersonen auf den Umgang mit KI vorbereitet und wie sie berufsbegleitend unterstützt werden können, um Lernprozesse mit Hilfe von KI optimal zu gestalten. Damit wird auch die Frage aufgenommen, was Lehrpersonen über KI wissen müssen und welche Fähigkeiten benötigt werden, um KI fachlich fundiert, kritisch und verantwortungsvoll zu nutzen.
Verantwortliche Redaktionsmitglieder: Bruno Leutwyler und Markus Weil